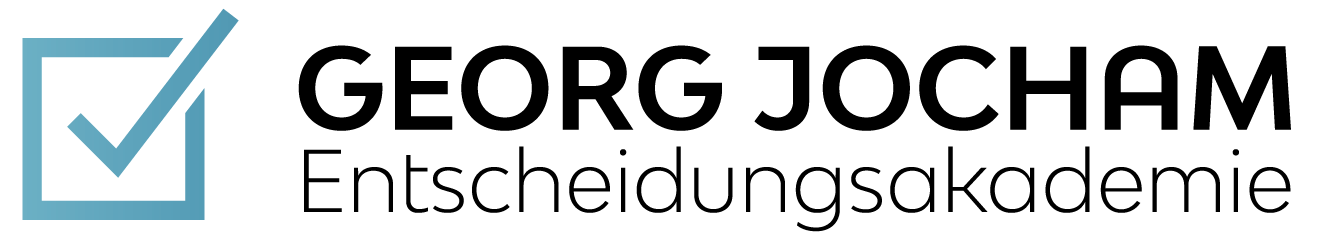Am 22. März, das ist ein Dienstag, werde ich beim renommierten Controller Institut in Wien ein Problemlöse-Seminar geben. Das Seminar hat den Titel „In 5 Schritten zum besseren Problemlöser“. Hier der Link:
Für Dich bzw. für Sie als Hörer gibt’s einen 25% Rabatt. Also schnell anmelden, solange es noch Plätze gibt! Um den Rabatt zu erhalten bitte bei der Anmeldung “Podcast-Junkie“ angeben!
Jetzt aber zum Thema der heutigen Episode.
Kürzlich gab es in der Zeitschrift Harvard Business Review einen Artikel mit dem schönen Titel „Are you solving the right problems?“, also „Lösen Sie die richtigen Probleme?“ von Thomas Wedell-Wedellsborg. Hier der Link zum Artikel:
https://hbr.org/2017/01/are-you-solving-the-right-problems
In dem Artikel werden einige Punkte adressiert, die mir sehr gut gefallen haben, daher mache ich heute eine eigene Episode dazu.
Der Autor beginnt damit, dass viele Unternehmen laut eigener Einschätzung gut darin sind Probleme zu lösen. In einer Umfrage gaben allerdings 85% der Top-Manager an, dass ihr Unternehmen schlecht darin sei Probleme zu diagnostizieren. Das muss man sich bildlich vorstellen, mehr als 8 von 10 Unternehmen sind schlecht darin Probleme zu diagnostizieren, das heißt genau zu verstehen, worin das Problem eigentlich liegt. Da muss man natürlich die Frage stellen, wie hilfreich es ist, wenn man gut darin ist Probleme zu lösen, wenn man so schlecht darin ist ein Problem zu diagnostizieren.
Ich muss da an einen Arzt denken, der zwar extrem gut darin ist das Problem meines Schnupfens zu lösen, dabei aber meine Lungenentzündung nicht diagnostiziert. Also super darin Probleme zu lösen, aber Diagnose, na ja, ist halt nicht so das seine. Da würde ich eher nicht mehr hingehen… das heißt, wenn ich’s überlebe
Was wir da sehen und was sich auch in dieser Umfrage zeigt, ist ein klassisches Muster: wenn ein Problem auftaucht, dann wechseln die allermeisten sofort in den Lösungsmodus ohne zu prüfen, ob das Problem wirklich verstanden ist.
Als Grund dafür, dass Probleme so wenig verstanden werden, führt Wedell-Wedellsborg an, dass es zwar oft einen Problemdiagnoseprozess gibt, dass dieser aber häufig overengineered ist, und damit aufwändig und abschreckend. Das heißt, es gibt zwar Werkzeuge dafür, wie zum Beispiel Six Sigma, aber die Verwendung braucht eine eigene Ausbildung. Und die Methode ist aufwendig, jedenfalls zu aufwendig, als dass man sie mal schnell in einem Meeting einsetzen könnte. Genau dort bräuchte man die Methode aber, denn genau dort werden Probleme diskutiert.
Außerdem, so die Kritik, sind das regelmäßig Werkzeuge, die eher in die Tiefe gehen und nicht so sehr welche, die einem helfen den Blick zu weiten. Das heißt sie helfen das Problem im Detail noch besser zu verstehen. Sie helfen aber nicht dabei zu prüfen, ob man denn an den richtigen Dingen arbeitet.
Das gefällt mit alles sehr gut und spiegelt auch meine Erfahrung wieder…
Als Ausweg empfiehlt der Autor „Reframing“. Für Reframing gibt es keine gute wörtliche Übersetzung ins Deutsche. Frame heißt Rahmen, Reframing bedeutet also etwa „etwas in einen neuen Rahmen geben“.
Als Beispiel wird die Situation der Tierheime in den USA genannt. Rund 40% der Haushalte in den USA haben ein Haustier. Und pro Jahr landen rd. 3 Millionen Hunde in Tierheimen. Das ist schon schlimm genug, vor allem für die Hunde. Leider finden nur 1,5 Millionen von diesen 3 Millionen einen neuen Besitzer. Da muss man jetzt nicht viel rechnen um zu sehen, dass sich das nicht ausgeht. Und das ist natürlich ein Problem, einerseits für die Hunde selbst, andererseits für die Tierheime, die das ja auch irgendwie finanzieren müssen.
Auf den ersten Blick sieht das aus wie ein Adoptionsproblem. Und die Frage, die man sich stellt, könnte lauten: wie schaffe ich es mehr Besitzer für Hunde in Tierheimen zu finden? Unglücklicherweise ist das die Frage, die man sich seit Jahren stellt. Man ist damit ein gutes Stück weiter gekommen, immerhin schafft man es die Hälfte der Hunde wieder an neue Besitzer zu geben. Allerdings ist es wie so oft bei Maßnahmen, die es schon gibt. Die kann man natürlich noch besser machen, die ganz großen Sprünge sind aber nicht zu erwarten.
Also hat die Organisation „Downtown Dog Rescue“ in Los Angeles eine andere Frage gestellt. Nämlich nicht: wie sorgen wir dafür, dass mehr Tiere aus dem System heraus vermittelt werden? Sondern: wie sorgen wir dafür, dass weniger Tiere bei Tierheimen landen?
Zuerst hat man sich angesehen, woher die Tiere kommen. Und siehe da, rund 30% der Hunde, die ins Tierheim kommen, werden von Ihren bisherigen Besitzern hingebracht. Bei vielen Menschen hat sich das Bild eingeprägt, dass das unmenschliche Tierhasser seien, die ihre Hunde wie Konsumgüter einfach wegwerfen, wenn es nicht mehr passt. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass es das nicht ist, dass das tatsächliche Problem an der Stelle ein Armutsproblem ist. Wenn etwa die Familie in eine neue Wohnung zieht und der Vermieter möchte eine zusätzliche Kaution wegen des Hundes, dann können sich das viele Familien nicht leisten. Oder aber das Tier braucht eine Untersuchung beim Tierarzt oder eine Impfung. Bei manchen Menschen in Los Angeles ist das einfach nicht drin.
Was hat man also gemacht? Bei Downtown Dog Rescue wird jedem, der seinen Hund vorbeibringt, eine Frage gestellt: „Wenn Sie könnten, würden Sie Ihr Tier behalten wollen?“ Und wenn die Antwort JA ist, dann versucht der Mitarbeiter dabei zu helfen das Problem zu lösen. Erforderlichenfalls auch mit Geld. Auf den ersten Blick klingt das ein wenig abstrakt, es gibt aber einen sehr konkreten Nutzen. Die Anzahl der Tiere ist deutlich gesunken, weil 75% aller Personen, die gefragt wurden, ihr Tier behalten wollten. Drei Viertel, das muss man sich mal vorstellen! Und auch die durchschnittlichen Kosten, die für jedes Tier aufgewendet werden, sind gesunken. Also ein schönes Beispiel für ein gelöstes Problem, bei dem es nur Gewinner gibt.
Schließlich gibt der Wedell-Wedellsborg sieben Tipps, wie sich Reframing grundsätzlich anwenden lässt. Mir gefällt diese Aufstellung so gut, weil ich einiges davon routinemäßig auch in meinen Projekten mache…
Diese sieben Punkte muss man nicht alle durchlaufen, man kann sich auch die ein oder zwei heraussuchen, die gerade passen. Und das schöne ist, das geht auch nebenher in einem Meeting.
Der Autor nennt dieses Methodenset „einen logischen Kontrapunkt zum Rapid Prototyping“, und auch das gefällt mir sehr gut.
- Dafür sorgen, dass Reframing eine anerkannte Methode ist
Ganz wichtig! Eine Methode in einem Meeting anwenden ist schwierig, wenn man der einzige ist, der die Methode kennt und versteht. Daher am besten auf den Artikel in der Harvard Business Review verweisen, oder auf diesen Podcast, und dazu die Geschichte mit dem Tierheim in Los Angeles erzählen. Das sollte reichen.
- Außenstehende einbinden
Super Tipp! Damit habe ich sehr gute Erfahrungen, nicht zuletzt deshalb, weil ich oft schon selber die Rolle des Außenstehenden eingenommen habe. Wie weit außen die oder derjenige steht, kann man sich aussuchen, die Bandbreite reicht vom Mitarbeiter der gleichen Firma über einen Externen mit Branchenkenntnis bis hin zu einem Externen ohne Branchenkenntnis. Interne bieten sich an, wenn kulturelle Aspekte wichtig sind. Die besten Erfahrungen habe ich erstaunlicherweise mit Leuten gemacht, die weder das Unternehmen kennen noch aus der Branche sind. Das hört sich vielleicht ein wenig eigenartig an, aber das sind genau die Leute, die sich am leichtesten dabei tun die Fragen zu stellen, die Insider schon lange nicht mehr stellen, weil sie sich damit lächerlich machen könnten. Das wichtigste ist jemanden zu haben, der sich kein Blatt vor den Mund nehmen muss. Jemanden, der frei sprechen kann, will und darf. Oder umgekehrt: das darf niemand sein, der in einem Abhängigkeitsverhältnis zu der Gruppe steht, die das diskutiert. Sonst kommt da nichts Vernünftiges raus oder nur das, was ohnehin aus der Gruppe gekommen wäre. Außerdem: der Außenstehende ist nicht da, um eine Lösung zu finden, sondern um Input zu geben und Fragen zu stellen.
- Problemdefinition aufschreiben lassen
Ha, fast schon meine Lieblingsübung! Meistens ist es doch so: alle gehen in ein Meeting und glauben zu wissen, worum es geht, dann reden alle darüber, und dann gehen alle auseinander und glauben zu wissen worum es geht. Wenn man sie aber unabhängig voneinander befragt, dann ist das wie früher bei Herzblatt. Gibt’s die Sendung eigentlich noch? Da haben auch alle geglaubt sie verstehen sich gegenseitig, und wenn man sie im Anschluss unabhängig voneinander befragt hat, dann wollte der eine heiraten und die andere wollte ihn nie wieder sehen. So ähnlich ist das auch bei vielen Themen, die wir tagtäglich in Meetings besprechen.
Wie kann man dem begegnen? Indem man die Leute bittet aufzuschreiben, woran es ihrer Meinung nach hakt. Und das nicht im Brainstorming-Stil mit Flipchart, sondern in Ruhe. Also entweder im Vorfeld eines Meetings oder in aller Ruhe im Meeting, jeder für sich. Frage an die Wand schreiben, 5 Minuten Zeit. Die Ergebnisse sind regelmäßig sehr breit gefächert und uneindeutig. Sie sind jedenfalls eine gute Basis um zu fragen, was denn tatsächlich das Problem ist.
- Fragen, was fehlt
Auch das ist ganz einfach. Wenn man die Problemdefinitionen aus der vorherigen Übung nimmt, dann sollte man die Frage stellen, was fehlt. Das heißt, gibt es einen Aspekt des Problems, der nicht ausdrücklich auf dem Papier steht. Oft kann genau das helfen auf ganz neue Ideen zu kommen.
- Unterschiedliche Problemkategorien ins Auge fassen
Probleme lassen sich in die unterschiedlichsten Kategorien einsortieren. Im Beispiel mit dem Tierheim in Los Angeles haben alle geglaubt es sei ein Problem, wie man mit den Tieren umgeht, die in den Tierheimen sind. Eine Lösung hat man aber gefunden, indem man die Frage gestellt hat, wie man viele Tiere erst gar nicht in die Tierheime bekommt. Also von einer Output-Orientierung zu einer Input-Orientierung. Die Frage, ob man gerade in der richtigen Problem-Kategorie ist, kann man sich immer stellen. Haben wir ein Ertragsproblem oder ein Kostenproblem? Haben wir ein Umsatzproblem oder ein Profitabilitätsproblem? Haben wir ein technisches Problem oder ein Service-Problem? Haben wir ein Effizienzproblem oder geht es erst mal um die Effektivität? Ist es der Prozess oder ist es die Useability? Und so weiter… Dazu fragt man einfach in die Runde „welche Art von Problem haben wir?“ und „Was wäre, wenn wir stattdessen ein XY Problem hätten?“
- Positive Ausnahmen suchen und analysieren
Nehmen wir an wir haben ein Problem. Dann kann man einfach fragen „was war anders, als wir das Problem nicht hatten“. Häufig fällt einem dann etwas auf, was man im ersten Moment gar nicht auf dem Radar hatte. Und vielleicht ist das schon eine geeignete Lösung.
- Das Ziel hinterfragen
Eines der Grundprinzipien des sogenannten Harvard Prinzips in der Verhandlung ist es, zu verstehen, welches Ziel die Verhandlungspartner haben. Wenn sich zwei um eine Zitrone streiten, dann will der eine vielleicht nur den Saft, während der andere mit der Schale einen Kuchen backen will. Eine Lösung finden die beiden nur, wenn sie wechselseitig ihre Ziele hinterfragen und diese auch transparent machen.
Zusammenfassend kann ich den Artikel von Thomas Wedell-Wedellsborg sehr empfehlen. Den Link gibt’s wie gesagt in den Shownotes.
Dennoch ein Wort der Warnung: Reframing ist ein guter Start, die Lösung muss dennoch im echten Leben passieren. Die Auseinandersetzung mit Kunden und das Pilotieren und Prototypen bleiben einem dadurch nicht erspart. Man läuft aber schon mal in die richtige Richtung, und das ist viel wert.