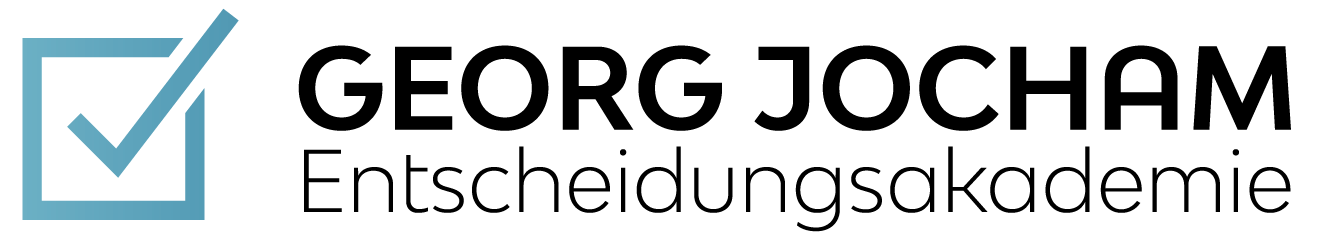Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in der heutigen Episode ist so einiges anders als sonst. Daher ein paar Worte der Erklärung, bevor ich zum inhaltlichen Teil komme.
Zum ersten ist das die Episode 49 einhalb. Das ist natürlich irgendwie eigenartig, hat aber einen einfachen Hintergrund. Vor einiger Zeit habe ich die 50. Episode aufgenommen, in der ich den von mir hochgeschätzten Olaf Kapinski zu Gast habe. Wir kommen im Interview auch darauf zu sprechen, dass es eben die 50. Episode ist und da kann ich dann schlecht die 51. Episode draus machen.
Gleichzeitig und das ist auch schon mein Zweitens – gehören ein paar Dinge gesagt, und zwar genau jetzt.
- Meine neue Website ist online, ab sofort läuft mein Web-Auftritt unter georgjocham.com. Meine bisherige Seite war in erster Linie der Server für meinen Podcast, die neue Seite ist erheblich schöner und kann auch erheblich mehr. Da gibt es neben dem Podcast einen Blog, für den ich regelmäßig Beiträge schreiben werde, und man kann künftig auch kommentieren, sowohl die Podcast-Episoden als auch die Blog-Beiträge. Ich freue mich sehr, wenn Sie mich auf meiner Seite besuchen, die Adresse ist www.georgjocham.com.
- Ich mache hier und heute das erste Mal ausdrücklich Werbung in meinem Podcast. Und zwar ist es unbezahlte Werbung für Matthias Gmeiner, der mir diese wunderbare Website gemacht hat. Super Typ, ausgezeichnete Betreuung, kann ich nur weiterempfehlen. Im Netz findet man ihn unter www.matthiasgmeiner.com. Lieber Matthias, vielen Dank für die Unterstützung, und mögen Dir meine Hörer die Tür einrennen mit ihren Anfragen! 🙂
- Auf meiner neuen Website gibt es bei Anmeldung für meinen Newsletter mein erstes richtiges, richtiges Ebook. Es trägt den Titel „10 Problemlösungsmythen – Problemlösungsfehler, die Sie gerne anderen überlassen dürfen“. Ganz wichtig: da findet sich auch einige Inhalte, die im Podcast bisher noch nicht vorgekommen sind.
- Nachdem ich die Website ändere, ändert sich auch im Hintergrund einiges, d.h. der Podcast kommt künftig von der neuen Seite. Ich bin da ein bisschen nervös, hoffe aber, dass alles klappt und Sie keinen Unterschied merken. Wenn doch, d.h. wenn Sie auf einmal meinen Podcast nicht mehr abonniert haben, dann abonnieren Sie ihn bitte neu. Ach ja, auch das Podcast-Cover sieht jetzt anders aus, die beiden denkenden Köpfe auf grünem Hintergrund sind Geschichte. Ab sofort gibt’s ein neues Logo, also bitte nicht wundern!
- Letzter Punkt, bevor ich thematisch einsteige, habe ich eine Bitte an Sie, liebe Hörer. Ich möchte den Podcast gerne etwas interaktiver gestalten, und dazu brauche ich Sie.
Es ist nämlich so. Natürlich habe ich einen Redaktionsplan mit Themen und Interviewpartnern für den Podcast bis weiß ich nicht wann. Gleichzeitig bin ich aber auch für Anregungen dankbar, was Sie gerne hören möchten. Was möchten Sie denn gerne hören?
- Wenn Sie also ein Thema sehen, das ich bisher nicht oder nicht in ausreichender Tiefe behandelt habe, dann schreiben Sie mir!
- Wenn Sie ein konkretes Problem sehen, das Sie gerne im Podcast diskutiert, seziert und strukturiert hätten, dann schreiben Sie mir. Das kann ein Problem sein, dass Sie haben. Es kann aber auch ein Problem sein, dass Sie sehen, bei sich in der Firma, oder ganz wo anders.
- Wenn Sie jemanden kennen, der zum Thema Methoden- und Problemlösungskompetenz etwas zu sagen hat, oder wenn Sie einen jemanden kennen, der ein Problem ganz besonders gut gelöst hat, dann schreiben Sie mir! Ich werde dann versuchen den- oder diejenige als Interviewgast zu gewinnen.
- Wenn Sie mir Feedback zum Podcast geben möchten, dann tun Sie auch das gerne, entweder per Mail oder noch lieber in Form einer iTunes Bewertung. Ich werde öfter gefragt, wie genau man eine iTunes-Bewertung macht. Dauert keine Minute und tut auch nicht weh. Dazu wird es bald einen Eintrag in meinen Blog geben.
Hier noch meine Emailadresse: info@georgjocham.com. Ich freue mich auf Ihre Nachricht! 🙂
Nun aber zum Thema der heutigen Episode.
Wissen verändert Verhalten nicht
Viele Maßnahmen um Verhalten zu ändern sind im Wesentlichen Informationsmaßnahmen. Wir kennen das aus dem täglichen Leben. Werbekampagnen und die Aufschriften auf Zigarettenpackungen klären über die gesundheitlichen Folgen des Rauchens auf, Sportverbände werben mit der gesundheitsfördernden Wirkung von Sport und Magazine im Wartezimmer unseres Hausarztes klären über Risiken im Zusammenhang mit ungesunder Ernährung und Fettleibigkeit auf.
Aber hilft das? Ändern Menschen auf Grund von Informationen ihr Verhalten? Ich habe vor Jahren dazu einen sehr guten Vortrag gehört, leider kann ich heute nicht mehr sagen, wer ihn gehalten hat. Bei mir hat dieser Vortrag jedenfalls Eindruck hinterlassen.
An einer Hochschule, ich glaube es war eine Sporthochschule hat man eine Untersuchung gemacht.
In einem ersten Schritt hat man eine repräsentative Gruppe von Menschen befragt. Man hat diese Menschen zuerst gefragt, ob sie sportlich sind. Da musste sich dann jeder auf einer Skale von 1 bis 10 eintragen, also vollkommen unsportlich war 0 und sehr, sehr sportlich war eben 10.
Dann hat man diese Menschen gefragt, ob sie gerne Bewegung machen. Wieder Skala von 1 bis 10, „ich verabscheue Bewegung“ (das war 0) bis „ich liebe Bewegung“ (das war 10).
Man hat dann die Ergebnisse in hübsche Diagramme eingetragen, und siehe da, bei beiden Fragen gab es eine Gruppenbildung. Es gab also bei der Frage nach der Spotlichkeit eine Häufung im unteren Drittel der Skala und eine weitere im oberen Drittel der Skala. Also nicht gleichmäßig verteilt, sondern eine Gruppe sieht sich eher als unsportlich und die andere Gruppe sieht sich eher als sportlich.
Und ziemlich ähnlich hat es ausgesehen bei der Frage, ob man gerne Bewegung macht. Auch hier eine Häufung im unteren Drittel und eine weitere im oberen Drittel. Und interessant, die Damen und Herren, die gerne Bewegung gemacht haben, haben sich selber als sportlich gesehen, und die, die nicht so gerne Bewegung gemacht haben als eher unsportlich.
Was man daraus mitnehmen kann, ist schon mal spannend. Mit dem Sport beginnen, zum Beispiel weil man abnehmen will, oder weil man gesünder leben will, oder was weiß ich. Wenn man nicht gerne Bewegung macht, dann wird das schwierig.
Die Untersuchung ging aber noch weiter.
Im zweiten Schritt hat man alle Teilnehmer gefragt, ob sie denn der Meinung wären, dass Sport gesund ist. Wieder kam die Skala zum Einsatz, sie reichte von „ich glaube überhaupt nicht, dass Sport gesund ist“ (das war 0) und „ich bin 100%ig davon überzeugt, dass Sport gesund ist“ (das war 10).
Und bei dieser Frage hat das Ergebnis ganz anders ausgesehen, als bei den ersten beiden Fragen. Es gab nicht zwei Häufungen, es gab eine Häufung, und zwar im oberen Drittel der Skala. Was bedeutet das. Die meisten Menschen waren davon überzeugt, dass Sport gesund ist.
Und trotzdem hat dieser Glaube (insofern dieser Glaube gut abgesichert ist, kann man ihn auch als Wissen bezeichnen) gut die Hälfte nicht dazu bewegen können Sport zu treiben. Vielmehr waren diese Menschen ihren Emotionen („ich mag mich nicht bewegen“) deutlich näher als ihrem Wissen („Sport ist gesund“). Ob sie Sport mochten – oder eben nicht – war entscheidend, was sie über Sport wussten – dass er gesund ist – nicht.
Und das war es, was ich aus diesem Vortrag mitgenommen habe. Wissen, insbesondere solches Wissen, das uns ohnehin bereits vorliegt, führt nicht dazu, dass wir etwas ändern.
Mit anderen Worten, es bringt nichts, wenn die öffentliche Hand Werbung für mehr Sport macht, die Leute wissen, dass es gesund ist, und viele machen trotzdem keinen Sport. Und es bringt nichts, wenn man zu den gesundheitlichen Risiken des Rauchens Kampagnen macht. Die Leute wissen das. Und es ändert nichts.
Und schließlich, und darauf will ich eigentlich hinaus. Wenn Manager ihren Mitarbeitern die schlechten Zahlen vorbeten, in der Hoffnung, dass die Mitarbeiter sich oder auch nur irgendetwas ändern, dann bringt das nichts. Wenn wir Menschen bewegen wollen, dann geht das über Emotion oder über Gewohnheiten, am besten über beides. Über Information und Wissen aber geht es nicht besonders gut.
Zum Abschluss zwei Zugänge, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe, wenn man Mitarbeiter in Bewegung bringen will.
- Das einfachste: die Mitarbeiter mit den Kunden reden lassen. Wenn Mitarbeiter von den eigenen Kunden gesagt bekommen, wie es denen mit den Produkten und dem Service geht, dann wirkt das. Also einfach mit dem Aussendienst 1-2 Tage auf den Weg schicken, das löst oft wirklich etwas aus.
- Was man auch machen kann: in einem Workshop das Unternehmen, oder den Bereich, oder nur die Abteilung als Person zeichnen lassen. Jede Gruppe bekommt die Aufgabe sich die Organisation als Person vorzustellen, diese zu beschreiben, also Alter, Geschlecht, Hobbies, Freunde, usw. und diese Person dann auch zu zeichnen. Ich habe bei dieser Übung schon öfter in betretene Gesichter gesehen, wenn die Mitarbeiter gemerkt haben, dass die Person, die sie da gezeichnet haben, ungefähr das Gegenteil dessen ist, was sich die Kunden erhoffen und erwarten würden.